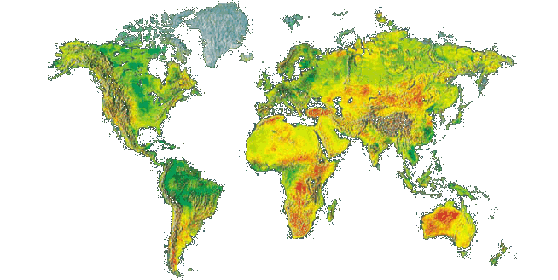
Leseprobe aus unserem Band I (Stand 2001):
Wie viel Geld man verdient oder hat, wofür man es ausgibt und was man dafür bekommt spielt eine Rolle
Ich werde oft gefragt: „Was hat glücklich sein mit Geld zu tun?" Um mal gleich die Katze aus dem Sack zu lassen: Das kommt ganz darauf an, wie viel man davon hat. Und zwar um so mehr, je weniger
man davon hat und um so weniger, je mehr man davon hat. Zwar besteht ein riesengroßer Unterschied zwischen dem, ob man „überhaupt kein“ oder „genug“ Geld hat, aber
weniger Unterschied zwischen dem, ob man „genug“ oder „sehr viel“ Geld hat.
Wie jeder weiß,
bleibt für den, der im blanken Elend lebt und bei dem sich alles ums nackte Überleben dreht, wenig Platz und Zeit zum Glücklichsein. Wer hungert, dürstet, friert, Angst vor dem Morgen und kein Dach
über dem Kopf hat, kann zwar hie und da Glücksgefühle haben aber schwerlich glücklich sein. Deshalb ist auch der Nutzen des Geldes zur Steigerung des“ Glücks und Wohlbefindens für die Ärmsten und Armen am größten, flacht aber mit zunehmenden Einkommen ab:
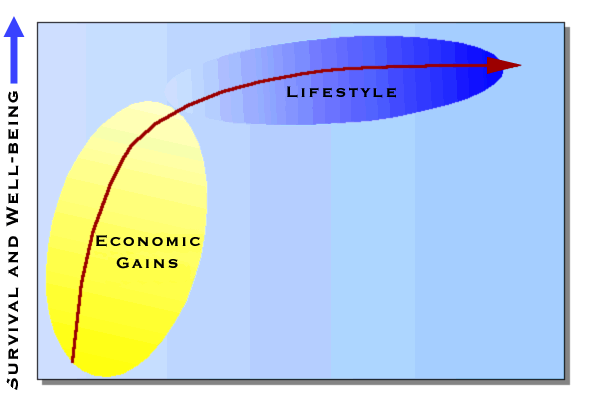
0 > > > > > > > > Steigendes Einkommen > > > > > > > > > > > >
© by Inglehart, Ronald und Klingenmann, Hans-Dieter, The MIT Press, 2000
Um die eingangs gestellte, uralte Frage: „Was
hat glücklich sein mit Geld zu tun?“ aber bestmöglich beantworten zu
können, geht die internationale Glücksforschung seit mehr als 35 Jahren regelmäßig von
drei unterschiedlichen
Forschungsansätzen aus:

Beim ersten Forschungsansatz1),2) führen Glücksökonomen, -soziologen und -forscher internationale Glücksvergleiche zwischen Ländern durch. Tatsächlich liegen die
Bürger der reichen Länder bei allen internationalen Glücksvergleichen stets in der oberen Gruppe und die Einwohner der armen Länder stets in der unteren. So bezeichneten sich beispielsweise in einer EU-Umfrage nur 10 Prozent der Portugiesen als
„sehr glücklich“, aber 40 Prozent der Holländer und zwischen 40 und 50 Prozent der Dänen. Diese liegen zusammen mit den
Isländern und den nordischen Ländern Schweden, Finnland und Norwegen, der Schweiz, USA und anderen reichen
Ländern, darunter auch Deutschland, stets in der
oberen Gruppe aller Glücksvergleiche, während arme Schlucker wie Bulgaren, Griechen,
Portugiesen, Tschechen, Inder und
insbesondere die Russen und alle Ex-Kommi-Länder stets die Schlusslichter im der unteren Gruppe bilden. Griechenland und Portugal sind, nur nebenbei bemerkt, die
ärmsten EU-Länder:
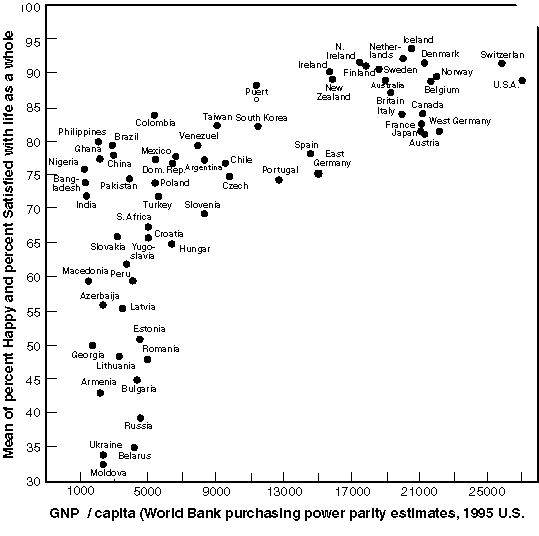
Copyright © by Inglehart, Ronald und Klingenmann, Hans-Dieter, The MIT Press, 2000
Die wohlhabenden Japaner schneiden allerdings trotz ihres beträchtlichen Wohlstands stets schlechter ab, als die Bürger kulturell westlich orientierter
Industrieländer. Die Japaner sind - trotz ihres beträchtlichen Wohlstands -
seit Jahrzehnten stets weniger
glücklich als die Bürger westlicher Kulturen und Wertesysteme. Das liegt vor allem an
ihrer kollektivistischen Kultur, in deren Mittelpunkt das Wohlergehen der Gemeinschaft steht und die vor allem Harmonie und Pflichterfüllung
gegenüber der Gruppe und Gesellschaft verlangt und weniger Wahlfreiheiten
und -möglichkeiten, wie man sein eigenes Leben einrichten will, zur Befriedigung
der individuellen Wünsche und Bedürfnisse zulässt.
Ganz allgemein gilt, dass Menschen in kollektivistischen, das
heißt das Gemeinwohl betonender Kulturen, wie die japanische, stets
weniger glücklich sind als Menschen, die in westlich orientierten,
individualistischen, das heißt die Individualität des Einzelnen berücksichtigenden, Kulturen leben, in denen das Wohlergehen des Einzelnen im Mittelpunkt steht und das Erleben,
Äußern und Ausdruck von angenehmen Gefühlen erwartet, unterstützt
..., ja geradezu gefordert wird.
Das hohe Einkommen allein kann es also nicht sein, und ist es auch nicht, dass die Bürger der
reichen Länder glücklicher macht. Denn, obwohl sich beispielsweise das
inflationsbereinigte Netto-Durchschnittseinkommen in den USA in den letzten 50
Jahre mehr als verdreifacht hat, nahm das Glück der Amerikaner
keinen Deut zu, sondern blieb trotz des
verdreifachten Wohlstands unverändert hoch. Ähnliche Ergebnisse haben wir auch aus Frankreich, Deutschland und Japan.
Beim zweiten
Forschungsansatz führen Glücksforscher Glücksvergleiche
innerhalb eines Landes, zwischen seinen Bürgern durch. Vielleicht
meinen Sie, mein verehrter Leser, ein höheres Einkommen mache glücklicher und
deshalb sei Reichtum das einzig wahre Endziel? Mitnichten mein
göttlicher Freund, mitnichten. Zunächst einmal: Geld ist ein Tauschmittel und ein Mittel zum Zweck (und kein Endziel) und somit nicht alles (Gewöhnlich reicht es leider nicht aus.)
„Ein reicher Mann“, sagte einmal zutreffend der reichste Mann seiner Zeit Aristoteles Onasis, „ist oft ein armer Mann mit sehr viel Geld.“
In amerikanischen Glücksstudien schlugen sich die materiellen Bedingungen nur mit einer Abweichung von weniger als
fünf Prozent im Glückshaushalt nieder. Zwar weiß ein altes deutsches Sprichwort, dass Geld nicht
glücklich macht, aber an das Treibmittel „Money, money, money“ klammern sich unzählige Sehnsüchte, und hartnäckig hält sich das Vorurteil, die Reichen müssten eigentlich glücklicher sein als wir.
Sind sie zwar, aber nicht unbedingt alle.
Die Wechselwirkung zwischen Reichtum und Glück ist nach Meinung des Oxford-Professors Michael Argyle „erstaunlich gering.“ Einkommen und Vermögen haben einen überraschend schwachen, - tatsächlich, praktisch bedeutungslosen - Einfluss auf unser
Glück und Wohlbefinden, der nicht der Rede wert ist.
Mehr zu verdienen ist auch deshalb für unser
Glück und Wohlbefinden nicht erforderlich,
weil es mit steigendem Einkommen kaum zunimmt.
Zwar sind Euro, Schweizer Franken oder Dollar exakt feststellbare objektive Größen, können aber
für jeden Menschen etwas ganz anderes bedeuten, je nachdem,
wie sie empfunden werden, was ihm fehlt, wer sie verdient, und wie sie ausgegeben werden.
In der Tat. Es kommt auf die individuell von Mensch zu Mensch
unterschiedlichen Beurteilungen des Einkommens an. Jede Bewertung und Beurteilung liegt aber in den Augen des Betrachters. „Viele Menschen stören ihr eigenes Wohlbefinden mit falschen
Erwartungen. Sie wollen nicht nur glücklich sein, sondern am besten noch ein bisschen glücklicher als die, die sie kennen und mit denen sie sich vergleichen. Und das ist deshalb so schwierig, weil
sie die anderen normalerweise für glücklicher halten, als sie es tatsächlich sind.“ Die Schulfreundin, die eine tolle Karriere gemacht hat, die Super-Modells in den Frauenzeitschriften,
der Bruder, der Onkel, die Schwester, die Cousine, die Kollegin mit dem gut aussehenden Mann, den lieben und erfolgreichen Kindern und der riesigen Wohnung,
Haus, Wochenendhaus, Boot und der Mitgliedschaft im Tennis oder gar Golf Club -, die
müssen ja wohl glücklicher sein, oder? Müssen sie überhaupt nicht.
Wer so denkt unterliegt einem Trugschluss und stellt eine Milchmädchen-Rechnung
auf, wenn er von den altbekannten, falschen Vorstellungen ausgeht und von den
eben genannten Tatsachen auf ihr Glück und Wohlbefinden schließt.
Sauberes Wasser, Nahrung, Wohnung, Kleidung und Sicherheit sind die Grundlagen des materiellen
Wohlbefindens. Sobald diese Grundbedürfnisse aber einmal befriedigt sind,
zählt zunehmender Wohlstand erstaunlich wenig. Auch bei Lotto-Millionären pegelte sich ihr
Glücksniveau bald wieder auf seinem Normalniveau ein. Nachdem es anfangs raketenartig in die
Höhe schoss, sank es - der schier unbegrenzten menschlichen Anpassungsfähigkeit und Gewöhnung an
die neuen Lebensumstände entsprechend - spätestens nach
einem halben Jahr wieder auf das Normal-Niveau herab.
Auch hier gilt das sattsam bekannte Sättigungsgesetz:
Andauerndes Vergnügen verliert seinen Reiz. Außerdem beurteilen wir uns als
„arm oder reich" immer im Vergleich mit anderen. Mit größerem
Reichtum verkehren wir aber in anderen Kreisen mit neuen Bekannten, und in ihnen sind
(leider wieder) einige Leute, die reicher sind als wir. Und wir sind plötzlich wieder
„arm".
Der Besitz besitzt. Er macht uns kaum unabhängiger und
glücklicher. Jeder Gegenstand, den wir haben, wirkt und - so unglaublich es klingen mag - macht seine eigenen
Ansprüche geltend. Je mehr Gegenstände wir haben, desto mehr Ansprüche müssen wir befriedigen. Sie dienen nicht nur uns, sondern auch wir
müssen ihnen dienen. Und wir sind oft mehr ihre Diener, als sie die unseren. Glücklich wird nicht der, der
sich ständig neue Luxusgegenstände kaufen kann, an denen er schnell wieder seine
Freude verliert, sondern
der, der sich klar macht, dass er längst hat, was ihn glücklich
machen kann. Wer sich klar macht, was er schon hat, statt immer neuen Verlockungen hinterher zu jagen, hat von vornherein schon
augenblicklich ein höheres Glücksniveau.
In der High Society der USA stuften 100
Multi-Millionäre (Forbes-Liste, jeder mindestens 125 Millionen Dollar schwer) ihr Wohlbefinden nicht bemerkenswert besser ein, als 100 zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählter Durchschnitts-Amerikaner.
„Happy" fühlten sich 67 Prozent der Super-Reichen und 62 Prozent der
Durchschnitts-Amerikaner. Die Amerikaner Angus Campbell und seine Kollegen kamen im Rahmen ihrer
- als klassisch bezeichneten - Studie „The Quality of American
Life“ schon 1976 zum selben Schluss: „Die finanzielle Situation eines Menschen
gehört zu den unbedeutenden Dingen seines Lebens. Viel Geld zu haben“, so schlussfolgerten sie, „ist kein Mittel um glücklich zu
werden.“
Auch Riesen-Glücksfälle haben nur vorübergehend Einfluss auf unser
Glück und Wohlbefinden. Spätestens drei bis sechs Monate (vielleicht schon am nächsten Tag) nach dem Lottogewinn oder Karrieresprung pegelt sich die Stimmung wieder auf dem gewohnten Normalniveau ein. Es gibt eine Menge armer Leute, die glücklich und zufrieden sind und keinerlei Anstrengungen machen, irgend etwas dagegen zu tun. Es geht wirklich nicht darum,
wie viel man verdient oder hat, sondern darum, von wie wenig man glücklich und zufrieden leben kann.
Vergnügt zu sein, ohne Geld, das ist's, das ist der Stein der Weisen.
Unser „Elend“ besteht nicht im Nichthaben der Dinge, sondern im Verlangen
nach den Dingen. Andererseits gibt es eine Menge unglückliche Superreiche, und
das überrascht uns auch wiederum nicht, wenn man die schwache Wechselwirkung zwischen Reichtum und
Glück kennt und weiß, dass es immens wichtigere Glücksquellen als Reichtum gibt.
Aber, ich verstehe die Superreichen. Wofür denn, um alles in der Welt,
sollen sie auch ihr Geld ausgeben, wenn nicht
für bestes Essen, beste Autos, Yachten, Vergnügungen, Luxus und Veranstaltungen aller Art? Was
sollen sie mit ihrem Geld machen, ohne diese
Genüsse? Das Geld dient zum guten Leben (und nicht das Leben zum Anhäufen von
Geld.)
.Mit steigendem Einkommen steigen unsere Ansprüche. Je mehr aber unsere
Wünsche und Bedürfnisse bereits befriedigt sind, desto geringer sind
die zusätzlichen Glücksgewinne, die jeder weitere Einkommenszuwachs mit sich
bringt. Je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig. Sind die
Mindestbedürfnisse einmal befriedigt, geben einem die kleinen Freuden des Lebens
das größtmögliche
Glück: Gute zwischenmenschliche Beziehungen, eine gut funktionierende, intime Partnerschaft oder
ein guter Freund, ein erfülltes Berufsleben - all das macht, alles in allem und
summa summarum, glücklicher als ein Lotto-Gewinn.
Das Fazit der internationalen Glücksforschung lautet deshalb fast wie ein Satz aus einem Kinder-Schulbuch. Auch wenn es unglaublich banal und heuchlerisch klingt: Ein hohes Einkommen mag zwar beruhigen - glücklicher aber macht es nicht. Denn mit Geld verhält es sich wie mit der Gesundheit und jedem anderen Gut: Sein Mangel mag zwar Trübsal, Jammer, Leid und Elend verursachen, aber es zu haben garantiert kein Glück. Wegen der schier unendlichen Anpassungsfähigkeit des Menschen gewöhnen
wir uns nämlich sehr schnell an neue Lebensumstände, und wenn die Grundbedürfnisse einmal befriedigt sind, bringt jeder weitere Zuwachs an Einkommen einen immer kleineren Glückszugewinn. Nicht der heiß ersehnte Lottogewinn oder BIG BANG, sondern viele kleine bing, bing, bing, bing machen
uns glücklich.
Beim dritten, für uns am
interessantesten, weil genauesten und aussagekräftigsten Forschungsansatz ...
1) Inglehart, Ronald: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. Campus Verlag, Frankfurt/M. 1989.
2) Inglehart, Ronald: Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften. Campus Verlag, Frankfurt/M. 1998.
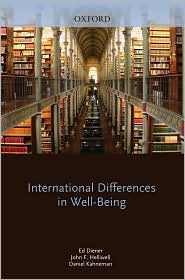
Ed Diener, Daniel Kahneman und John Helliwell (Hrsg.):
International Differences in Well-Being
Sprache: Englisch
512 Seiten
Oxford University Press, USA
Erscheinungsdatum: 10. März 2010
66,67 €
Copyright © 1999 - 2015 by Dipl.-Kfm. Dipl.-Hdl. Bernd Hornung. Alle Rechte vorbehalten.
IFG München
Institut für Glücksforschung
Peter-Putz-Str. 12
81241 München
Tel.: 089 88 96 91 97
Fax: 01805 060 334 082 62
www.gluecksforschung.de
E-Mail an uns: glueck.und.wohlbefinden@t-online.de



